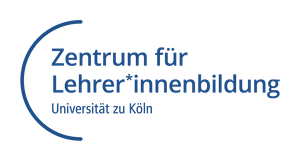Ziele der Beobachtung einschränken
Um die subjektiven Momente der Beobachtung zu reduzieren empfiehlt Topsch1, die Ziele der Beobachtung von Beginn an einzuschränken und ihnen eine Fragerichtung oder einen Theorierahmen zu geben. So kann die Aufmerksamkeit der beobachtenden Person auf einen Punkt fokussiert werden.
Beobachtungen können z.B. den Unterricht in seiner Struktur (Methoden, Sozialformen, etc.), die Aktionen des Lehrenden oder die Aktionen der Schüler*innen betreffen. Gefühle oder Intentionen hingegen können nicht einfach beobachtet werden.
[FL-EOP-ZielederBeobachtungeinschraenken]
SchülerInnenhandlungen
Die Beobachtungen können sich auf unterschiedliche Bereiche des Schüler*innenverhaltens konzentrieren, z.B. Mitarbeit im Unterricht, Kontaktverhalten zur Lehrperson, Kooperationsverhalten mit anderen Schüler*innen, Lern- und Arbeitsverhalten, nicht zielorientierte Aktivitäten während des Unterrichts, o.ä.
Unterrichtsprozesse
Den Unterricht als Ganzes zu erfassen, ist ein sinnvolles aber relativ schwieriges Unterfangen, weil vieles gleichzeitig geschieht. Hilfreich ist es laut Werner Topsch (2002), zeitliche Strukturen zu erfassen. Bitten Sie den/die Lehrer*in um eine Information über die groben Schritte des geplanten Unterrichts. So können Sie Ihre Mitschrift nach Unterrichtsphasen gliedern. Sie können beispielsweise eine Unterrichtsphase bei unterschiedlichen Lehrpersonen oder in unterschiedlichen Fächern beobachten.
LehrerInnenhandlungen
Die beobachteten Lehrpersonen sind Modelle, mit denen Sie sich bewusst auseinandersetzen sollten. Es geht laut Werner Topsch (2002) dabei nicht darum, bestimmte Verhaltensweisen zu kopieren, sondern Handlungsmuster zu isolieren, analysieren und zu reflektieren. Sie können stoffliche, methodische und/oder zwischenmenschliche Aspekte im Unterricht oder außerunterrichtlich - z.B. in Elterngesprächen, Lehrer*innenkonferenzen o.ä. - beobachten.
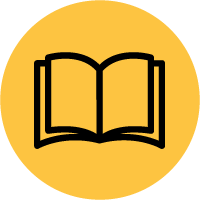 Literatur
Literatur
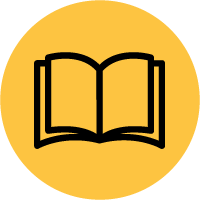 Literatur
Literatur1vgl. Topsch, Werner (2002): Beobachten im Praktikum – wie geht das? In: Grundwissen: Schulpraktikum und Unterricht. Neuwied/Kriftel 2002, S. 31-44.