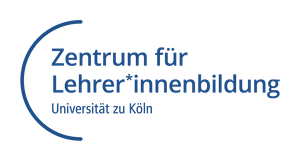Sicherer Ort
Seit vielen Jahren hat die Arbeit mit dem sicheren Ort in der Traumapädagogik und Traumatherapie einen besonderen Stellenwert. Viele Kinder und Jugendliche, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, sind verunsichert und haben kein Vetrauen mehr in ihre Umgebung. Um dieser Verunsicherung entgegenzuwirken, brauchen sie Stabilität, Halt und den sicheren Ort. Die Bereitstellung eines sicheren Ortes ist eine sehr wichtige Grundlage für Kinder und Jugendliche mit Komplexer Behinderung, um erfolgreich im schulischen Kontext lernen zu können.1 Dabei wird der sichere Ort vor allem in zweierlei Hinsicht verstanden:
1. Der Mensch mit Traumatisierung wird darin unterstützt sich in seiner Imagination einen sicheren Ort vorzustellen. Dazu werden die Menschen dazu angeleitet, sich Orte auszumalen, an denen sie sich sicher fühlen. Diese werden dann in Worten beschrieben, manchmal auch gemalt. Sie werden zu einem inneren Zufluchtsort, den Menschen aktivieren können, wenn sie sich verunsichert fühlen.
2. Das Konzept des sicheren Ortes wird auch dazu angewandt, die Schule als sicheren Ort zu konzipieren. Menschen mit traumatischen Erfahrungen und damit existenziellen Verunsicherungen brauchen eine möglichst haltende und geborgene und damit auch sichere Umgebung. Alles was dem dient, sollte unterstützt werden.2
Folgende Bestandteile sind für den schulischen Kontext für die Bereitstellung eines sicheren Ortes grundlegend:
- Ein bewusster Umgang mit Dissoziation*,
- verschiedene Beziehungs- und Bildungsangebote,
- Respekt zeigen vor der Lebensleistung,
- Transparenz herstellen, Trauma und Dissoziation enttabuisieren,
- Strukturen bieten, die Konstante und Halt bieten,
- Stress und Beschämung minimieren.2
 Im Akkordion finden Sie Beispiele zur Strukturierung des Schulalltags, welche ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes des sicheren Ortes ist. Klicken oder tippen Sie auf die Begriffe.
Im Akkordion finden Sie Beispiele zur Strukturierung des Schulalltags, welche ein wesentlicher Bestandteil des Konzeptes des sicheren Ortes ist. Klicken oder tippen Sie auf die Begriffe.
 Um etwas zum Time Out zu erfahren, klicken oder tippen Sie auf dieses Icon.
Um etwas zum Time Out zu erfahren, klicken oder tippen Sie auf dieses Icon.
 Um etwas zum Time Out zu erfahren, klicken oder tippen Sie auf dieses Icon.
Um etwas zum Time Out zu erfahren, klicken oder tippen Sie auf dieses Icon.Für Schüler*innen mit Komplexer Behinderung sind Time-out Phasen im Unterricht eine gute Möglichkeit sich aus herausfordernden Situationen zu entziehen. Diese Phasen sollten mit jedem Kind individuell besprochen werden. Sie sollten nicht als Strafe angesehen werden, sondern als Entspannungsvariante. Die Schüler*innen können selbst entscheiden wann sie gehen und wann sie wieder zurück zur Klasse kommen. Auch in Pausensituationen kann die Time-out Regelung genutzt werden. Da die Pausensituationen mit vielen anderen Schüler*innen und einem großen Schulhof für traumatisierte Kinder oft sehr überfordernd sind, kann man diesen Schüler*innen anbieten die Pause an einem geschützten Ort im Schulgebäude oder auf dem Pausenhof zu verbringen. Dies senkt das Stresslevel der Kinder und bietet ihnen die Möglichkeit eigenständig über ihre Pausengestaltung je nach Gemütszustand zu entscheiden.10
*Dissoziation: Der Begriff Dissoziation bezeichnet das (teilweise bis vollständige) Auseinanderfallen von psychischen Funktionen, die normalerweise zusammenhängen. Betroffen von dissoziativer Abspaltung sind meist die Bereiche Wahrnehmung, Bewusstsein, Gedächtnis, Identität und Motorik aber manchmal auch Körperempfindungen (etwa Schmerz und Hunger).
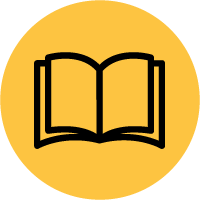 Literatur
Literatur
1 Vgl. Möhrlein, G./Hoffart, E. (2014): Traumapädagogische Konzepte in der Schule. In: Gahleitner, S./Hensel, T./Baierl, M./Kühn, M./Schmid, M. (Hrsg.): Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 95.
2 Vgl. Ding, U. (2014): „Ich kann mir sowieso nichts merken, also brauche ich auch nicht hin!“ Wie kann Schule dissoziierende Kinder verstehen und im Lernen unterstützen? In: Weiß, W./Friedrich, E./Picard, E./Ding, U. (Hrsg.): „Als wär ich ein Geist, der auf mich runter schaut“ Dissoziation und Traumapädagogik. Weinheim: Beltz, S. 184.
3 Vgl. ebd., S. 61.
4 Vgl. Jäckle, M. (2016). Schulische BildungsPraxis für vulnerable Kinder und Jugendliche. In: Weiß, W./Kessler, T./Gahleitner, S. (Hrsg.): Handbuch Traumapädaogik. Weinheim: Beltz Verlag, S. 155.
5 Vgl. Zimmermann, D. (2017): Traumatisierte Kinder und Jugendliche im Unterricht. Ein Praxisleitfaden für Lehrerinnen und Lehrer. Weinheim: Beltz. S. 118.
6 Vgl. ebd.
7 Vgl. Ding, U. (2014): „Ich kann mir sowieso nichts merken, also brauche ich auch nicht hin!“ Wie kann Schule dissoziierende Kinder verstehen und im Lernen unterstützen? In: Weiß, W./Friedrich, E./Picard, E./Ding, U. (Hrsg.): „Als wär ich ein Geist, der auf mich runter schaut“ Dissoziation und Traumapädagogik. Weinheim: Beltz, S. 62.
8 Vgl. Kühn, M. (2014). Traumapädagogik – von einer Graswurzelbewegung zur Fachdisziplin. In: Gahleitner, S./Hensel, T./Baierl, M./Kühn, M./Schmid, M. (Hrsg.): Traumapädagogik in psychosozialen Handlungsfeldern. Ein Handbuch für Jugendhilfe, Schule und Klinik. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 234.
9 Vgl. ebd.
10 Vgl. Ding, U. (2013): Trauma und Schule. Was lässt Peter wieder Lernen? Über unsichere Bedingungen und sichere Orte in der Schule. In: Bausum, J./ Besser, L./ Kühn, M./ Weiß, W. (Hrsg) (2013): Traumapädagogik. Grundlagen, Arbeitsfelder und Methoden für die pädagogische Praxis. Beltz Juventa: Weinheim und Basel. S. 64.