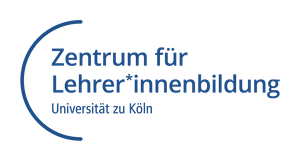Forschungskreis II
Der Schwerpunkt bezüglich der einzelnen Phasen kann je nach didaktischem Interesse unterschiedlich sein. In jeder Ihrer Praxisphasen durchlaufen Sie deshalb den Forschungskreis jeweils mit einer unterschiedlichen Schwerpunktsetzung.
In Vorbereitung Ihres Eignungs- und Orientierungspraktikum (EOP) liegt der Schwerpunkt auf den ersten drei Phasen des Forschungskreises. Die Besonderheit besteht darin, dass die anzuwendende Forschungsmethode – die Beobachtungsaufgabe – schon im Vorhinein feststeht. Diese Vorauswahl beeinflusst, wie Sie sehen werden, alle anderen Phasen des Forschungskreises.

Um mehr zu erfahren, fahren Sie über die Elemente in der interaktiven Grafik.

1. Vorüberlegungen
Bevor Sie eine Untersuchungsfrage entwickeln, sollten Sie einige Vorüberlegungen treffen. Welche Themengebiete würden für Ihre Untersuchung in Frage kommen? Was weiß ich schon über dieses Thema? Was interessiert mich speziell?
2. Entwicklung einer Fragestellung
Nachdem Sie sich für ein Interessensgebiet entschieden und sich darüber informiert haben, formulieren Sie Ihre Untersuchungsfrage zu diesem Themengebiet. Diese kann sich im Zuge Ihrer anschließenden Recherche noch einmal verändern, jedoch sollten Sie bereits mit einem Fokus in die Recherche starten.
3. Forschungsstand feststellen
Sie erarbeiten in diesem Schritt den aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand zu Ihrer Untersuchungsfrage. Benutzen Sie dazu wissenschaftliche Literatur. Nur wenn Sie den aktuellen Forschungsstand kennen, können Sie eine sinnvolle Fragestellung wählen und die Ergebnisse Ihrer nachfolgenden Untersuchung in den wissenschaftlichen Kontext einordnen. Nach dieser Recherche passen Sie Ihre Untersuchungsfrage ggf. an, um konkret forschen zu können.
In diesem Begleitkurs führen wir Sie in die Möglichkeiten der Literaturrecherche ein und geben Ihnen eine Checkliste und Kriterien zur Auswahl wissenschaftlicher Literatur an die Hand.
4. Entwicklung des Untersuchungsdesigns mit Auswahl der Methode(n)
Das Untersuchungsdesign dient dazu, den eigenen Forschungsprozess zu planen. Sie legen den Zeitplan Ihrer Forschung fest und strukturieren Ihr Vorgehen in sinnvollen Schritten.
Das Untersuchungsdesign und die Auswahl der Forschungsmethode(n) hängen häufig zusammen, sodass Sie mit einer Entscheidung für das eine die Auswahl für das jeweils andere beeinflussen.
Sie planen, wie Ihr methodisches Vorgehen aussieht (Erhebung und Auswertung). Machen Sie sich dabei mit möglichen Methoden vertraut und entscheiden, welche Methode(n) zur Bearbeitung Ihrer Untersuchungsfrage sinnvoll ist/sind. Stellen Sie unbedingt VOR Beginn der Durchführung sicher, dass Sie über die notwendige Methodenkompetenz verfügen.
Sie führen eine Beobachtungsaufgabe durch. Die Methode steht also bereits fest.
5. Durchführung
In diesem Schritt wird die zuvor gewählte Untersuchungsfrage auf Grundlage des Untersuchungsdesigns und der Methodenauswahl umgesetzt. In der Praxis wird z.B. eine Beobachtung gemacht, ein Interview geführt oder ein Fragebogen erhoben. Sie sollten während der Durchführung die Ergebnisse in einer vorher bestimmten Form dokumentieren (z.B. Tonaufnahme, Beobachtungsprotokoll).
6. Auswertung der daten
In diesem Schritt wird die zuvor gewählte Untersuchungsfrage auf Grundlage des Untersuchungsdesigns und der Methodenauswahl umgesetzt. In der Praxis wird z.B. eine Beobachtung gemacht, ein Interview geführt oder ein Fragebogen erhoben. Sie sollten während der Durchführung die Ergebnisse in einer vorher bestimmten Form dokumentieren (z.B. Tonaufnahme, Beobachtungsprotokoll).
7. Reflexion der Ergebnisse
Nun folgt die Reflexion Ihrer Untersuchungsergebnisse und des Forschungsprozesses. Welche Gedanken sind während des Prozesses aufgekommen? Welche Schwierigkeiten traten auf? Wie kann bei erneutem Durchlauf der Forschungsprozess verbessert werden? Konnte die Untersuchungsfrage eingehend geklärt werden? Welche Schwierigkeiten gab es bei der methodischen Umsetzung? Auf Grundlage dieser Reflexion verbessern Sie Ihr Verständnis und Ihre Kompetenz für forschende Tätigkeiten.
8. Dokumentation
Anschließend an die Auswertung und Reflexion schließt sich die Dokumentation Ihrer Untersuchungsergebnisse an. Sie halten Ihren (wissenschaftlichen) Erkenntnisgewinn fest und machen ihn für sich selbst und für andere nachvollziehbar. Zentrale Aspekte Ihrer Dokumentation sind die Belegbarkeit der Anwendung von wissenschaftlichen Gütekriterien während Ihres gesamten Forschungsprozesses und die Beantwortung Ihrer Fragestellung. Fragen, die sich aus Ihrer Forschung und Ihren Ergebnissen ergeben, halten Sie ebenfalls fest. Diese bieten ggf. wichtige Anschlussstellen für weitere Forschungsfelder.