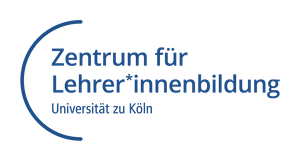Praxisbeispiel zum Forschenden Lernen
Um mehr zu erfahren, fahren Sie über die Elemente in der interaktiven Grafik.

Ausgangslage
Ein Blick in die Zukunft: Sie haben Ihre erste Stelle an einer Schule angetreten. Eine Ihnen zuvor unbekannte Klasse ist in Ihrem Unterricht über einen längeren Zeitraum, insbesondere in den Plenumsphasen, sehr unruhig, unkonzentriert und extrem laut. Spontane Versuche, die Klasse zu beruhigen, scheitern allesamt.
Mögliche Reaktionen
Mögliche Sanktionen Ihrerseits können vermehrte und strengere Sanktionen für einzelne Schüler*innen, häufigere Ermahnungen und Kollektivstrafen für die gesamte Klasse, die Herabsetzung der Note für "sonstige Mitarbeit" oder die Resignation und das Abfinden mit der Situation (Störung akzeptieren) sein.
Alternative Reaktion
Sie nehmen eine neutrale Position ein und gehen der tatsächlichen Ursache auf den Grund. Sie führen z.B. eine kurze anonyme Abfrage bei den Schüler*innen oder den Lehrerkolleg*innen Ihrer Klasse durch.Eine Lehrerin sagt: "In der Mathe-Doppelstunde, die ich vor Ihnen habe, sind die Schüler*innen sehr konzentriert. Wir wiederholen gerade das 1x1 sowie Addition und Subtraktion im Hunderterraum. Die Schüler*innen berechnen Aufgaben im Mathebuch und auf Arbeitsblättern." Sie vermutet, dass die Schüler*innen durch die längere Stillarbeitsphase in der Doppelstunde vorher einen starken Bewegungs- und Kommunikationsdrang aufgebaut haben.
Schlussfolgerung
Sie planen zur Beginn jeder Stunde ein 5-minütiges Aufwärmspiel zur körperlichen und kognitiven Aktivierung der Schüler*innen ein. Sie setzen in Ihrem Unterricht in dieser Klasse verstärkt auf kooperative Lernformen und eine hohe Eigenaktivität der Schüler*innen, um diese zu motivieren und das Miteinander zu fördern. Sie stimmen sich zudem mit Lehrerkolleg*innen der Klasse ab und einigen sich insgesamt auf ein einheitliches Konzept zur Nutzung verschiedener Sozialformen und Lernmethoden.